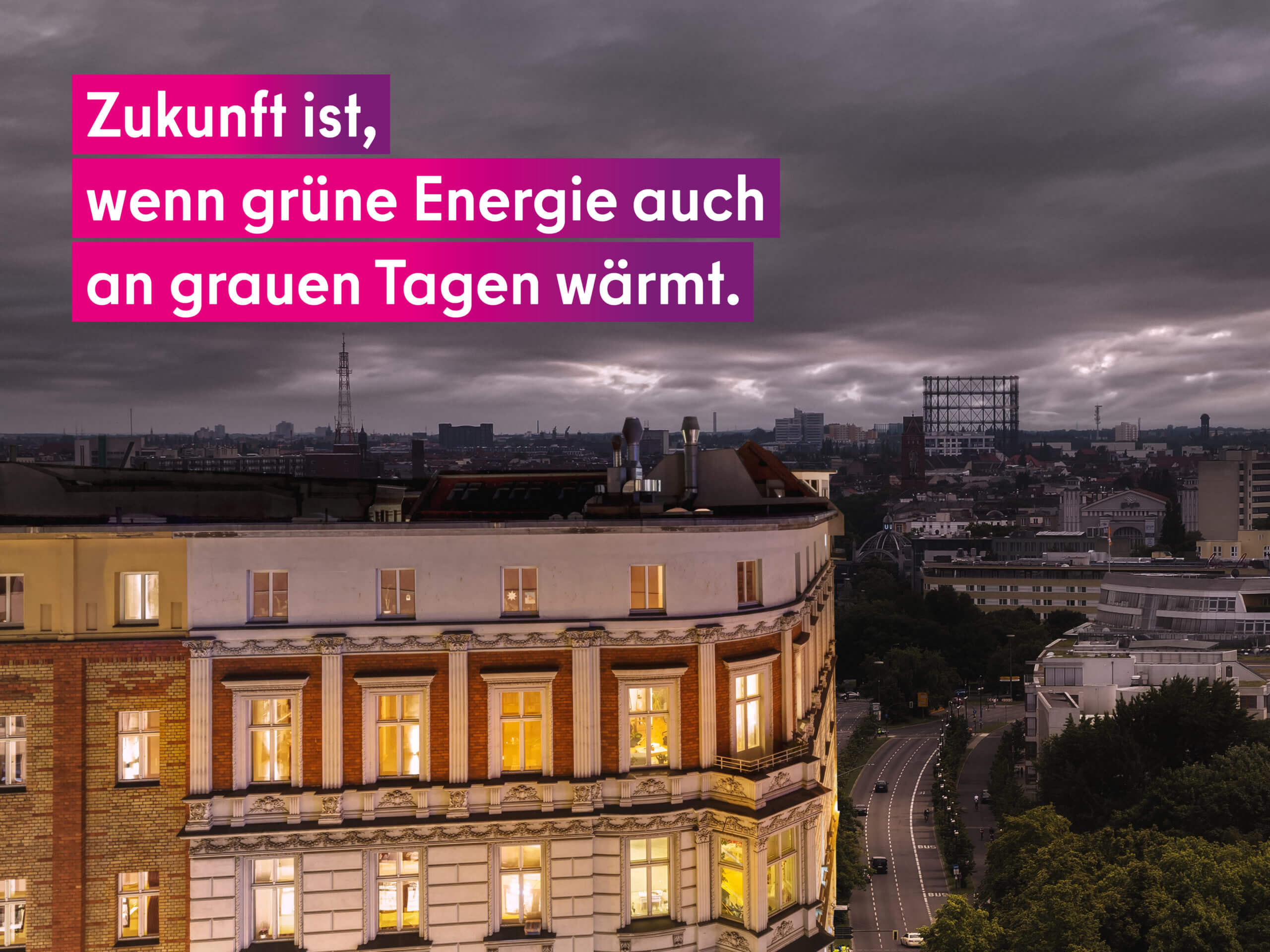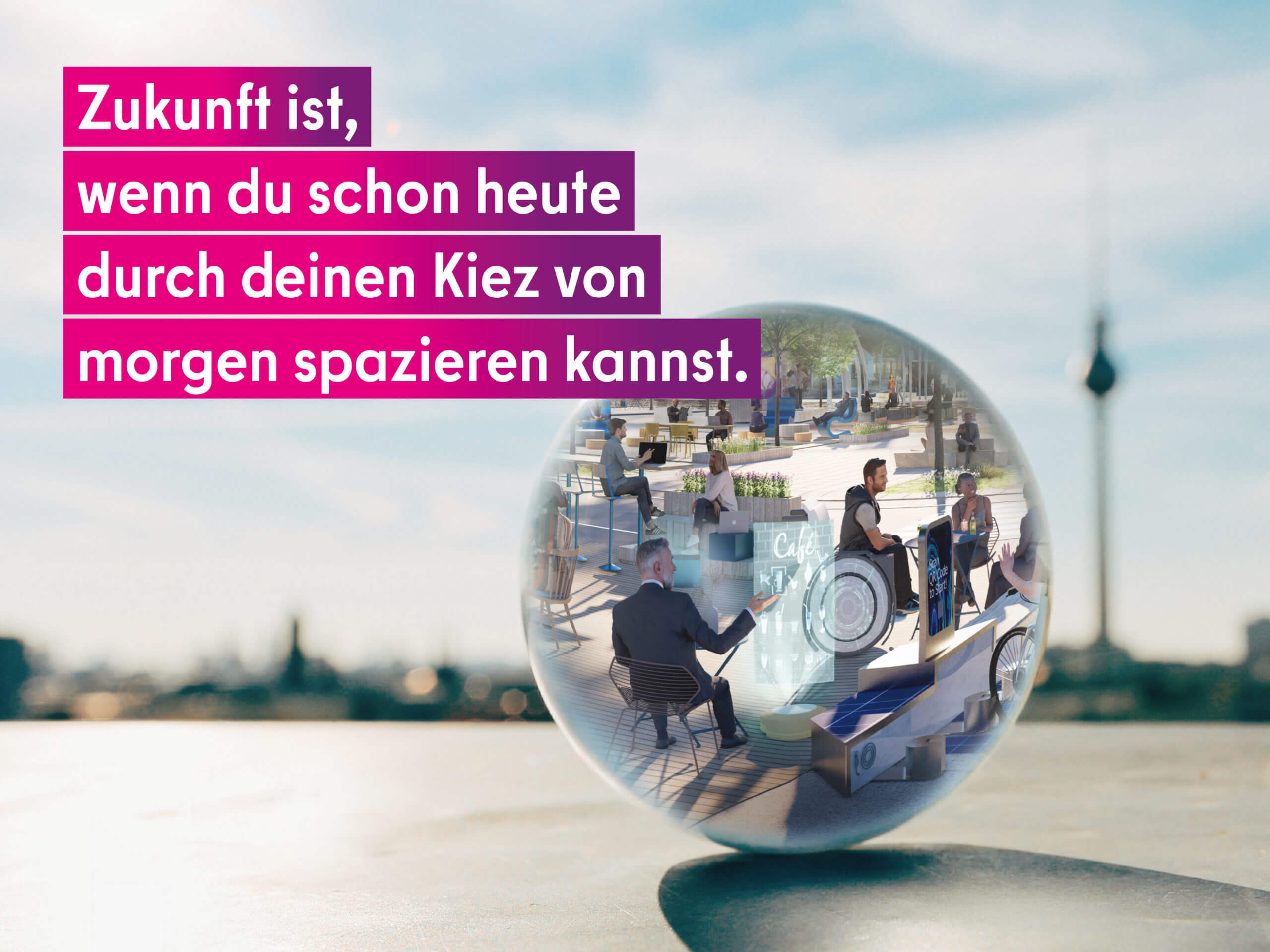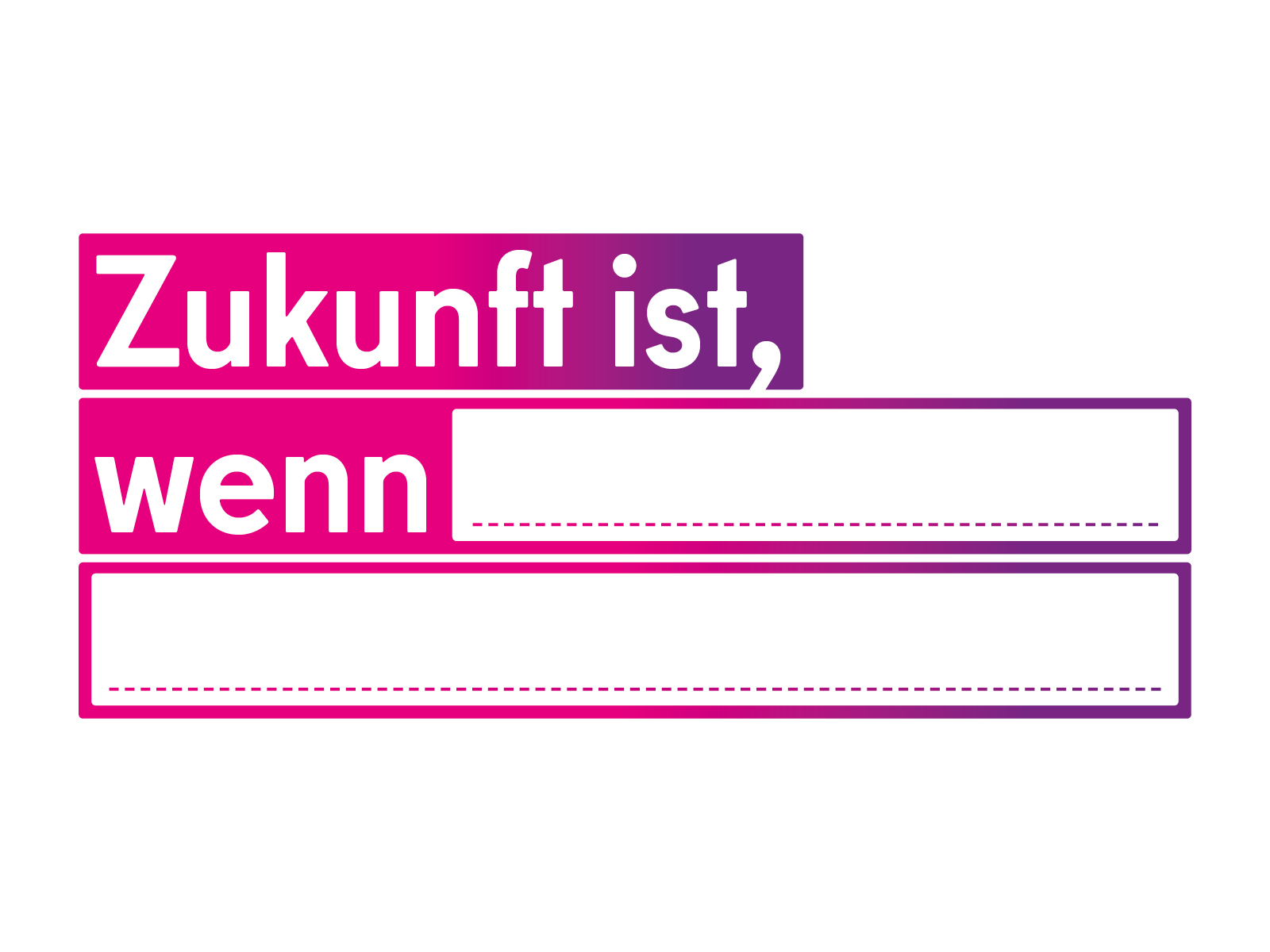
„Zukunft ist …“ – eine Kampagne über die spannenden Fragen der Zukunft
Wie können wir die Welt vom Plastikmüll befreien, die Artenvielfalt erhalten oder Krankheiten wie Krebs besiegen? Ist es möglich, das Leben für alle Menschen lebenswerter zu machen und gleichzeitig die natürlichen Ressourcen zu schonen? Das und noch viel mehr sind die spannenden Fragen der Zukunft. An den Antworten zu diesen Fragen wird an den 11 Zukunftsorten Berlins in über 2.000 Unternehmen geforscht und gearbeitet.
Im Rahmen der Kampagne stellen wir einige dieser Projekte und ihre Standorten vor. Wir wollen damit die Vielfalt der internationalen Unternehmen und Wissenschaftseinrichtungen an diesen 11 Standorten zeigen. Und damit die Innovationskraft, die die Zukunftsorte, unterstützt durch die Berliner Politik und die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, in die Hauptstadt bringen.
Aber wir möchten vor allen Dingen eines: Mit dieser Kampagne zu zeigen, dass es viele Gründe gibt, optimistisch in die Zukunft zu schauen. Sie soll möglichst vielen Menschen Mut und Lust machen, sich an einem dieser Zukunftsthemen zu beteiligen. Lassen Sie sich von den wegweisenden Projekten begeistern, lernen Sie das europaweit einzigartige Netzwerk Zukunftsorte kennen. Es gibt viel zu entdecken.
Zukunft ist, wenn die ganze Republik auf Urban Tech steht.
Mit dem Zukunftsort Berlin TXL – Urban Tech Republic entsteht am ehemaligen Flughafen Tegel ein Ort, an dem mit modernen Technologien an der Zukunft der Städte gearbeitet wird. Bis 2050 werden voraussichtlich 80 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben. Damit die Städte der Zukunft lebenswert, sozial und nachhaltig sind, werden in dem Zukunftsort kreative Ideen entwickelt und urbane Lebensräume neu gedacht. Hier werden neben der Berliner Hochschule für Technik (BHT) bis zu 1.000 Unternehmen zu Themen wie Mobilität, Energie und Bauen forschen, entwickeln und produzieren.
Zukunft ist, wenn ein Denkmal ans Klima denkt.
Der Zukunftsort Flughafen Tempelhof wird 100 Jahre alt. Als Europas größtes Architekturdenkmal, entwickelt er sich zu einem Experimentierort und Stadtquartier für Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft. Gleichzeitig spielt dieser Ort eine wichtige Rolle für ein klimagerechtes Berlin: die vollständige Sanierung der Technischen Infrastruktur macht aus dem Flughafen THF ein klimaneutrales Denkmal und leistet einen wichtigen Beitrag beim Übergang in eine ressourceneffiziente und kreislauforientierte Wirtschaft.
Zukunft ist, Industrie Nachhaltigkeit produziert.
Am Zukunftsort CleanTech Marzahn entwickeln und produzieren Unternehmen innovative Produkte für eine saubere und ressourcenschonende Wirtschaft. Als Berlins größtes Industrieareal bietet der CleanTech Business Park eine vielfältige Infrastruktur, damit zukunftsorientierte Betriebe viel Platz zum Wachsen haben und aufstrebende Unternehmen vom Know-how des Netzwerks profitieren. Der Standortfokus auf Life Science und Biotechnologie sowie Energie- und Umwelttechnologien soll sich nachhaltig positiv für Mensch und Natur auswirken.
Zukunft ist, wenn Kinderherzen nichts mehr fehlt.
Der Zukunftsort Berlin SÜDWEST verfügt mit dem Campus Dahlem über einen der größten Wissenschaftsstandorte Deutschlands. Im Life Science-Bereich werden hier neue Maßstäbe gesetzt, auch im Bereich der Kindergesundheit.
Über die Unternehmen
Berlin Heart, die in unmittelbarer Nähe zum Charité Campus Benjamin Franklin Herzunterstützungssysteme für Kinder entwickeln und weltweit vertreiben, gehört zu den Marktführern der Branche. An der Freien Universität Berlin werden zudem Lösungen für die psychische Gesundheit von Kindern geschaffen: die Präventions-App Mondori© hilft, Kinder und Jugendliche nachhaltig mit Therapiemethoden zu stärken. Und das Startup Aumio hat eine preisgekrönte App zum Thema Achtsamkeit und Meditation für Kinder entwickelt.
Zukunft ist, wenn es kürzere Wege, aber nicht mehr Straßen gibt.
Als ehemals wichtigster Industriestandort Berlins ist der Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Berlin Schöneweide heute Zentrum für Unternehmen und die Hochschule für Technik und Wirtschaft, die sich an der Schnittstelle von Technologie, Industrie 4.0 und Wissenschaft bewegen. Hier wird intensiv an der Stadt der Zukunft geforscht und innovative Lösungen für Themen von Energie bis Mobilität entwickelt.
Über die Projekte
Im Projekt WAS-PAST wird ein neues Liefersystem für urbane Wirtschaftsverkehre getestet, um die negativen Umwelt- und Verkehrseffekte des städtischen Lieferverkehrs zu reduzieren und gleichzeitig Unternehmen und Menschen zuverlässig mit den benötigten Waren zu versorgen. Das Startup Kiezbote sammelt Pakete aller Versender und Lieferdienste zentral im Kiez und stellt sie auf Abruf per App mit dem Lastenrad in deinem Wunschzeitfenster zu. In Zukunft werden auch Lösungen des Warentransports über Wasser möglich sein.
Zukunft ist, wenn grüne Energie auch an grauen Tagen wärmt.
Am Zukunftsort EUREF-Campus forschen, lernen und arbeiten 5000 Menschen – und zeigen, dass die Energiewende machbar und bezahlbar ist. Ökologisch und ökonomisch nachhaltige Lösungen machen den Büro- und Wissenschaftscampus – der bereits seit 2014 die Klimaziele der Bundesregierung für 2045 erfüllt – zu einem europaweit einmaligen Zentrum für innovative Zukunftsprojekte. In einem engen Austausch und in zahlreichen Partnerschaften entwickeln Global Player, Start-ups sowie forschende und lehrende Einrichtungen intelligente Lösungen für die Stadt der Zukunft.
Zukunft ist, wenn du schon heute durch deinen Kiez von morgen spazieren kannst.
Mit dem Zukunftsort Siemensstadt Square entsteht inmitten der historischen Siemensstadt eine Blaupause für die ganzheitlich nachhaltige Stadt der Zukunft.
In einem einzigartigen Nutzungsmix verbinden sich Wohnen, Arbeiten, Forschen, Industrie und Lernen, Freizeit, Sport und Kultur fließend miteinander. Intelligente Siemens-Technologien und erneuerbare Energien machen das Areal im Betrieb CO2-neutral und versorgungssicher. Mit einem Digitalen Städte-Zwilling, einer digitalen Simulation des gesamten Quartiers, wird bereits ab der Planung die digitale mit der realen Welt verbunden – und in zehn Dimensionen geplant und umgesetzt. Siemensstadt Square bietet eine ideale Umgebung für technologieorientierte Unternehmen, die schon heute gemeinsam mit Siemens die Zukunft gestalten wollen.
Zukunft ist, wenn Häuser Klima machen und die Stadt essbar wird.
Als eines der größten zusammenhängenden innerstädtischen Universitätsareale Europas ist der Zukunftsort Campus Charlottenburg einer der vielfältigsten Wissenschafts-, Kunst- und Gestaltungsstandorte Deutschlands. Hier kooperieren Institutionen aus Technologie und Kreativwirtschaft über disziplinäre Grenzen hinweg und erforschen gemeinsam Themen und Fragen für die Stadt von morgen. Diese Lösungen werden in Reallaboren erprobt und gezeigt. Zukunftsweisende Technologien der solaren Energieerzeugung, lokalen Wassernutzung und der Circular City werden hier entwickelt.
― ― ― ― ― ―
„Zukunft ist, wenn Häuser (gutes) Klima machen und die Stadt essbar wird!“
Podiumsdiskussion
Zum Re-Livestream 🔴 ➤ https://youtu.be/Tz8qOIfhNqk
Das Video wird von YouTube eingebettet und erst beim Klick auf den Play-Button von dort geladen und abgespielt. Ab dann gelten die Datenschutzerklärungen von Google.
― ― ― ― ― ―
Zukunft ist, wenn Plastikmüll Geschichte ist.
Am Zukunftsort „Berlin Adlershof“ entwickeln Forschende aus der Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik e.V., Mitglied der Zuse-Gemeinschaft, eine digitale Technik, Mikropartikel im Abwasser so aufzuspüren, dass sie herausgefiltert werden können und nicht in unsere Gewässer gelangen.
Über das Projekt
Beim Thema Plastik in der Umwelt drängt die Zeit. Jahr für Jahr gelangen laut Weltwirtschaftsforum mindestens acht Millionen Tonnen Kunststoffabfälle in unsere Weltmeere. Dort zersetzen sie sich zu gefährlichen Mikroplastikpartikeln.
Der Nachweis dieser Mikropartikel ist sehr zeitaufwändig. Das macht es bisher schwer, der rapide wachsenden Verschmutzung etwas entgegen zu setzen.
Zukunft ist, wenn die Bienen wiederkommen.
Am Zukunftsort „Technologie-Park Berlin Humboldthain“ wurde das Projekt „Sens4Bee“ von der microsensys GmbH initiiert und mit den Partnern Helmholtz Zentrum für Umweltforschung (UFZ) sowie Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM) realisiert. Ziel ist es mithilfe von integrierten Sensorsystemen in Bienenstöcken und an Einzeltieren genügend Daten zu erheben, um das Bienenwohl in Verbindung mit Umweltereignissen analysieren zu können. Das Projekt ist durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gefördert.
― ― ― ― ― ―
„Zukunft mitdenken – Bienen- und Artensterben stoppen: Was wäre, wenn …?“
Podiumsdiskussion mit drei Impulsvorträgen
Zum Re-Livestream 🔴 ➤ https://youtu.be/2lHcnowOiLw
Das Video wird von YouTube eingebettet und erst beim Klick auf den Play-Button von dort geladen und abgespielt. Ab dann gelten die Datenschutzerklärungen von Google.
― ― ― ― ― ―
Über das Projekt:
Neben den Honig produzierenden Völkern sind vor allem die Wildbienen durch ihre Bestäubungsleistung für die Landwirtschaft von immenser Bedeutung. Aus diesem Grund sorgen die steigenden Sterbezahlen von diversen Wildbienenarten weltweit für Aufregung. Doch trotz seiner Bedeutung und den allgemeinen Wissensstand über dieses Insekt sind die Ursachen für das Bienensterben noch weitestgehend unerforscht. Um besser zu verstehen, welche Umweltfaktoren für die Gesundheit von Bienenvölkern entscheidend sind, ist es notwendig, sowohl die Entwicklung ganzer Bienenvölker als auch die von Einzeltieren zu untersuchen.
Mehr Informationen
Zukunft ist, wenn Krebs nur noch ein Tier ist.
Am Zukunftsort „Berlin-Buch“ entwickelt T-knife neuartige Immuntherapien gegen Krebs: Sie bringen den T-Zellen von Patient*innen bei, solide Tumoren zu erkennen und zu bekämpfen. T-knife ist ein Spin-off des Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC) zusammen mit der Charité – Universitätsmedizin Berlin.
― ― ― ― ― ―
„Zukunft mitdenken – wenn Start-ups Krebs heilen“
Podiumsdiskussion mit Keynote von Elisa Kieback, CTO T-knife
Zum Re-Livestream 🔴 ➤ https://youtu.be/g2_Qo-kkCaM
Das Video wird von YouTube eingebettet und erst beim Klick auf den Play-Button von dort geladen und abgespielt. Ab dann gelten die Datenschutzerklärungen von Google.
― ― ― ― ― ―
Über das Projekt:
T-Zellen überwachen unseren Körper und schützen ihn vor Krankheiten, beispielsweise durch Infektionen mit Viren. Das funktioniert, weil kranke Zellen sich durch spezifische Antigene auf ihrer Oberfläche verraten. Spürt eine T-Zelle ein Antigen auf, zerstört sie die befallene Zelle oder mobilisiert weitere Kräfte gegen sie. Auch bei Krebszellen sitzen spezielle Merkmale auf der Oberfläche. Das Problem ist allerdings: Das Immunsystem erkennt diese oft nicht und bekämpft sie daher auch nicht.
Mehr Informationen